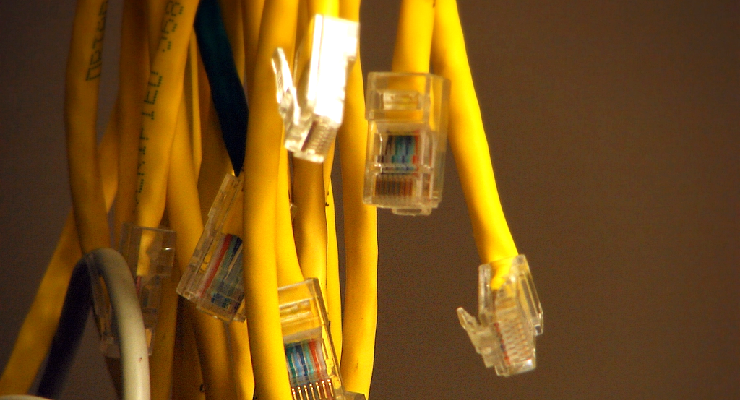
Jerry John/Flickr
in Eingeständnis vorab: Fast alle, die wir in der einen oder anderen Art und Weise Chefs sind (oder gewesen sind), haben ein gutes Stück vom „control freak“ in uns. Wir haben irgendwie das fast biologisch verortete Gefühl, auf unser wichtigstes „Aktivum“ – unser Personal – aufpassen zu müssen. Das fesselt sowohl uns selbst an das Büro als zentrale Werkstätte, wie es auch das Personal daran bindet.
Dabei könnte nichts unproduktiver sein, als diesbezüglich an irgendwelchen starren Regeln festzuhalten. Wir können nicht immer stärker einer hochentwickelten Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft das Wort reden und zugleich unverändert von der Präsenzpflicht und -kontrolle als Grundtatbestand ausgehen.
Die Maßstäbe des Maschinenzeitalters des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts an die Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts anzulegen wäre absurd – auch wenn so mancher Boss anscheinend noch in den Kategorien des Taylorismus denkt und schwelgt. Wer so handelt und führt, zeigt nur, dass er noch nicht verstanden hat, als wie produktivitätsmindernd sich diese Form einer gleichförmigen, ja „gleichgeschalteten“ Arbeitsorganisation in heutiger Zeit zwangsläufig erweist.
Je flexibler, vernetzter und virtueller unsere Arbeitswelt wird, umso antiquierter werden Arbeitsformen, die sich an reiner Präsenz und deren Messung orientieren.
Und je enger das Korsett, das den Mitarbeitern in Sachen Arbeitszeitgestaltung und Outputlieferung angelegt wird, umso weniger motiviert, leistungsbereit und firmentreu werden sie in Zeiten wachsenden Fachkräftemangels sein – zumal dann, wenn die Konkurrenz an dieser Stelle die Zeichen der Zeit bereits erkannt hat. Für Unternehmen, die althergebrachte Denkschemata kultivieren wollen, hat das handfeste betriebswirtschaftliche Konsequenzen.
Die Fesseln des Büros und der Präsenzpflicht endlich zu sprengen, ist in vielen Branchen und Berufsfeldern längst kein Ding der Unmöglichkeit mehr. Aber es ist noch zu wenig gelebte Praxis, wenn man von den Vorreitern etwa in der Softwarebranche absieht.
Mischformen aus Präsenz- und Fernarbeit werden sich zunehmend verbreiten – und im Extremfall kann sich morgen ein ganzer Betrieb virtualisieren und seine Belegschaften via Cloud zu immer neuen Arbeitsteams zusammenführen.
Die neuen Technologien schaffen große Chancen auch dort, wo bislang oft erhebliche Probleme vorhanden sind. Das gilt nicht nur für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern auch für Doppelkarrieren-Paare mit und ohne Kinder, wenn etwa ein Partner berufsbedingt umziehen muss. Auch der andere Partner könnte in Zukunft dann leichter als heute mit in eine andere Stadt, ein anderes Land, auf einen anderen Kontinent umziehen, ohne seinen eigenen Job aufgeben zu müssen, sofern er oder sie ihn virtuell erledigen kann.
Für alle von uns, die das Heer der Büroarbeiter ausmachen, sollte das kein Hindernis sein und schon gar nicht zur Auflösung eines bisher guten Arbeitsverhältnisses führen müssen. Umgekehrt kann ein Umzug aber auch ganz vermieden werden, wenn der neue Arbeitgeber einer ist, der RemoteArbeit anbietet.
Die Entfesselung der Arbeit von starren Orten und Zeiten bringt auf vielfältige Weise neue Dynamik und Produktivitätsvorteile mit sich. Selbst kleinere Dienstleister im hochqualifizierten Bereich können ihre Aufgaben dann rund um die Uhr erledigen, ähnlich dem, wie eine Investmentbank ihr Handelsbuch um den Globus weiterreicht.
Natürlich gibt es bei alldem auch Grenzen. Aber diese sollten an der Evidenz festgemacht werden, nicht aber – wie im deutschen Büroalltag immer noch zu häufig üblich – an abstrakten, starren und althergebrachten Regeln.
Die Dialektik der Personalführung bedeutet heutzutage – gerade dank neuer Instrumente wie der Cloud – vor allem eines: Je mehr wir den Mitarbeitern (zu)trauen und je mehr Vertrauen wir in das ganze Team stecken, desto reichlicher werden wir für dieses Vertrauen in Form gesteigerter Produktivität belohnt werden.
Der beste Beweis hierfür offenbart sich im Umkehrschluss. Wer an der „längeren Leine“, also ohne intensive, zeit- und damit kostenaufwendige Aufsicht, nicht genügend Selbstmotivation, Arbeitsdisziplin und Produktivität auf die Waage bringt, der signalisiert am Ende von sich aus, dass er oder sie vielleicht nicht der beste Mitarbeiter für das Team ist.
Warum also komplizierte Kontrollmechanismen aufbauen, um dies herauszufinden, oder gar weiter dem Irrglauben aufsitzen, Kontrolle mache die Mitarbeiter besser? Es sind die sinn- und reizvoll vorgegebenen Aufgaben und Ziele, nicht der Kontrollwahn, die die Mitarbeiter zur Leistung anspornen. Und, ehrlich gesagt, wie häufig sind wir als Personalverantwortliche nicht dem „Charme“ derer aufgesessen, die im Vergleich zu anderen Kollegen nur im Small Talk an der Kaffeemaschine besser waren?
Genau genommen ist die digitale Wolke, in der wir – ob Chefs oder Mitarbeiter – mehr und mehr agieren werden, so etwas wie eine virtuelle Nabelschnur. Sie ermöglicht es einem Teammanager beim intensiven Erledigen der eigenen Arbeitsaufgaben sehr wohl, zumindest peripher im Blick zu behalten, welche Aufgaben die diversen Mitarbeiter im Team gerade angehen oder – besser noch – erfolgreich abschließen. Diese Arbeit mag auf einem anderen Stern stattfinden, aber sie ist – ebenso wie die verantwortlichen Akteure – jederzeit präsent.
In der Welt der „remote work“ sind sich die Mitarbeiter ihrer neuen Freiheiten und auch der Tatsache bewusst, dass das ihnen entgegengebrachte Vertrauen ein Privileg ist, welches bei Missbrauch auch wieder entzogen werden kann. Eine erfolgreiche virtuelle Kooperation und Teamarbeit setzt voraus, dass alle Beteiligten sich aufeinander verlassen können. Insofern findet hier eine Form der „sozialen Kontrolle“ innerhalb der Teams statt, die diejenige des Chefs oder der Chefin gut und gern ersetzen kann.
Ein Teil der Motivation der neuen virtuell vernetzten Beschäftigten resultiert ohne Frage aus der unter Beweis gestellten Bereitschaft des Arbeitgebers, auf individuelle Arbeitszeitwünsche einzugehen. Anders gesagt: Kein Betrieb, der an motivierten und treuen Mitarbeitern interessiert ist, kann heute noch glaubhafte Ausreden formulieren, warum er seinen Beschäftigten die organisatorische Vereinbarung von Familie und Beruf zum Spießrutenlauf mit handfesten Karrierenachteilen macht.
Alle reden davon, das Arbeiten familiengerechter zu machen. Jenseits floskelhafter Absichtsbekundungen sollten sich entsprechende Schritte keineswegs nur darauf kaprizieren, dass Frauen etwa bessere Teilzeitarbeitslösungen angeboten werden.
Auch für die körperlich-geistige Regeneration und gesundheitliche Prophylaxe würde damit neuer Spielraum gewonnen. Was bringt es, wenn alle zur gleichen Zeit joggen, ins Fitnesscenter eilen und dann im Zweifel schon wieder im Verkehr hängen bleiben? Für viele ist die sportliche Aktivität unter diesen Vorzeichen nichts anderes als die Fortsetzung des Räderwerks, das die tägliche Arbeit ohnehin schon mit sich bringt. Den viel diskutierten Burn-out-Erscheinungen kann man sicher besser vorbeugen, wenn Arbeits- und Freizeit in dieser Hinsicht „entgrenzt“ werden.
Die Gewerkschaften sehen die Gefahr einer ganz andere „Entgrenzung“ in Form der völligen Vermischung von Arbeit und Eigenzeit. Doch dem kann man durch kluge Grenzziehungen entgegentreten. Kein Arbeitgeber kann vernünftigerweise die virtuelle Allgegenwart seiner Mitarbeiter erwarten, und kein Beschäftigter sollte so wenig Selbstdisziplin haben, sich permanent mit arbeitsplatzbezogenen E-Mails zu beschäftigen, nur weil Smartphone & Co. das rund um die Uhr und den Globus zulassen. Zynisch gesprochen: Hier werden sicher auch neue Marktchancen für Psychologen, Zeitmanagement-Consultants und Personal Coaches entstehen.
Wie produktiv und kreativ ein Umdenken an dieser Stelle ist, habe ich auch selbst mehrfach konkret erlebt, etwa als mich ein langjähriger Mitarbeiter vor einigen Jahren um die deutliche Lockerung seiner Präsenzpflicht in Büro bat, um die gemeinsame Zeit mit seinen beiden heranwachsenden Teenagern etwas intensiver erleben zu können. Ich würde es aus Produktivitätssicht nicht bereuen, sagte er mir. Und in der Tat, ich habe es keinen Tag bereut. Der Vertrauensvorschuss hat sich in noch fokussierterer Arbeit niedergeschlagen. Alle Beteiligten hatten von dieser Produktivitätssteigerung ihren sehr direkten Nutzen.
Gewiss: Gerade die Mischung von Prä- senz- und Fernarbeit, die bei jedem Beschäftigten zu anderen Kombinationen führen kann, verlangt den Vorgesetzten mehr gedankliche und organisatorische Flexibilität ab. Sie müssen damit aber nur ihrerseits unter Beweis stellen, was sie ihren Beschäftigten ja auch tagtäglich abverlangen. Die Fesseln der Präsenzkultur zu sprengen, ist reine Kopfsache.